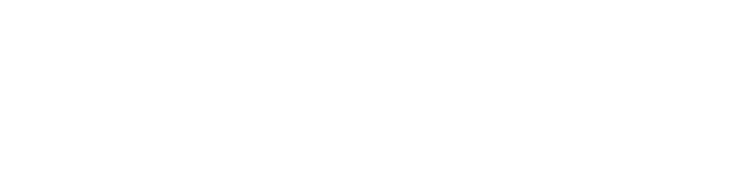Unwirksame Kündigung eines langjährig freigestellten Juristen wegen Nebentätigkeit in einer Anwaltskanzlei
Mit E-Mail vom 22.10.2021 teilte der Mitarbeiter der Arbeitgeberin mit, seine Wiederzulassung als Rechtsanwalt beantragt zu haben. Anfang 2022 gründete er zusammen mit dem Rechtsanwalt P. eine GbR. Am 14.01.2022 teilte der Mitarbeiter der Arbeitgeberin den Kanzleinamen mit und erklärte, in Auseinandersetzungen mit ihren Beschäftigten nicht als Sachbearbeiter tätig zu werden. Ein Schreiben vom 23.08.2023, unterzeichnet von Rechtsanwalt P., aber versehen mit dem Namen und dem Aktenkürzel des Mitarbeiters, betraf die Vertretung der rechtlichen Interessen einer Mitarbeiterin der Arbeitgeberin und deren beabsichtigte Entbindung von der Tätigkeit als Stationsleitung nebst Gehaltskürzung.
Die Arbeitgeberin beantragte am 07.09.2023 beim Personalrat die Zustimmung zu der beabsichtigten außerordentlichen, hilfsweise ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses mit dem Mitarbeiter. Zur Begründung der Kündigungen bezog sich die Arbeitgeberin auf die gegen sie geführten Mandate der Anwaltskanzlei und einen sich daraus ergebenden Verstoß des Mitarbeiters gegen die Loyalitätspflicht. Der Personalrat stimmte der Maßnahme zu. Daraufhin kündigte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis mit dem Mitarbeiter. Dieser klagte gegen die Kündigung.
Das Arbeitsgericht hat der Kündigungsschutzklage entsprochen. Die Behauptung der Arbeitgeberin, der Mitarbeiter sei jedenfalls im Hintergrund beratend tätig gewesen, reiche ebenso wenig aus wie das anwaltliche Aktenzeichen des Mitarbeiters auf dem Briefbogen. Abgesehen davon habe die Arbeitgeberi den Mitarbeiter zu keinem Zeitpunkt abgemahnt. Auf die Berufung der Arbeitgeberin hat das Landesarbeitsgericht die Entscheidung des Arbeitsgerichts bestätigt.
Die Nebentätigkeit des Mitarbeiters in der Anwaltskanzlei kollidierte dem zeitlichen Umfang nach nicht mit dem Arbeitsverhältnis, da er aufgrund der vollständigen Freistellung keine Arbeitsleistungen zu erbringen hatte. Die anwaltliche Tätigkeit verstieß nicht gegen das vertragliche Wettbewerbsverbot (§ 60 Handesgesetzbuch – HGB), da die Kanzlei kein Wettbewerber der Arbeitgeberin ist. Der Bezug von Einnahmen aus der Anwaltstätigkeit beeinträchtigte die Interessen der Arbeitgeberin ebenfalls nicht. Vielmehr verringerten sich dadurch ggf. die dem Mitarbeiter zu zahlenden Gehälter durch Erzielung anrechenbaren Zwischenverdienstes (§ 615 Satz 2 BGB).
Ob der Mitarbeiter in den Mandaten gegen die Arbeitgeberin – in welcher Art und Weise auch immer – im Hintergrund beratend tätig gewesen war, konnte dahinstehen. Selbst wenn er bei zumindest zwei oder auch vier Mandaten im Hintergrund beratend tätig gewesen wäre, also z.B. Schreiben entworfen, Mandantengespräche geführt oder einschlägige Rechtsprechung bzw. Literatur recherchiert hätte, lag angesichts der zu diesem Zeitpunkt annähernd fünf Jahre andauernden Freistellung mit Hausverbot und angesichts der Streitgegenstände sowie der vertretenen Personen keine pflichtwidrige, den Interessen der Arbeitgeberin zuwiderlaufende Nebentätigkeit vor. Selbst wenn eine beratende Tätigkeit im Hintergrund eine Pflichtverletzung darstellen würde, wäre diese nicht derart schwerwiegend, dass eine Abmahnung entbehrlich gewesen wäre.
Die – von der Arbeitgeberin behauptete – beratende Tätigkeit im Hintergrund wäre nur dann eine schwerwiegende Pflichtverletzung, deren Hinnahme erkennbar ausgeschlossen war, wenn die Interessen der Arbeitgeberin in erheblichem Umfang beeinträchtigt worden wären bzw. dies zu befürchten wäre, also etwa bei erheblichen materiellen oder immateriellen Schäden, einem Missbrauch vertraulicher Informationen bzw. interner Kontakte oder dem Einsatz unlauterer Mittel. Rechtliche Auskünfte bei kleineren Meinungsverschiedenheiten zählen jedenfalls nicht hierzu. Es war vielmehr davon auszugehen, dass der Mitarbeiter im Falle einer berechtigten Abmahnung nach Rücksprache mit dem anderen Gesellschafter davon abgesehen hätte, Mandate gegen die Arbeitgeberin in der Kanzlei zu bearbeiten.
Die hilfsweise ausgesprochene ordentliche Kündigung vom war nach § 1 KSchG unwirksam, da sie nicht durch Gründe im Verhalten des Mitarbeiters bedingt war. Es fehlte, wie dargelegt, an einer Pflichtverletzung.