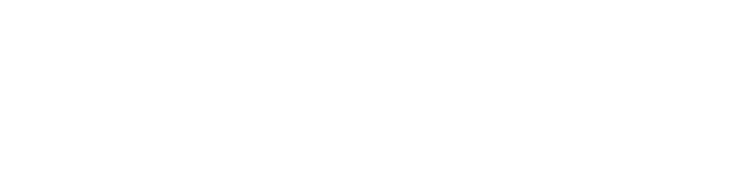15.000 EUR Entschädigung für permanente unzulässige Überwachung am Arbeitsplatz
Im Arbeitsvertrag hatte sich der Mitarbeiter damit einverstanden erklärt, „dass im Rahmen der Zweckbestimmung des Arbeitsverhältnisses und unter Beachtung der Vorschriften des Datenschutzes die personenbezogenen Daten verarbeitet werden können.“ Die Kameraüberwachung war Gegenstand eines Rechtsstreits, den die Parteien 2023 geführt hatten. Er wurde durch Vergleich am 21.11.2023 beendet. Darin verpflichtete sich die Arbeitgeberin u.a. dazu, dem Mitarbeiter Auskunft über die Kameras zu erteilen, insbesondere bezüglich deren Betriebszeiten, Anzahl, Aufnahmen und Speicherdauer.
Mit einer Klage im Jahr 2024 hatte der Mitarbeiter seine Ansprüche weiterverfolgt. Im Februar 2025 schlossen die Parteien einen Vergleich zur Erledigung eines Kündigungsrechtsstreits. Im vorliegenden Rechtsstreit nahm der Mitarbeiter die Arbeitgeberin auf Unterlassung der Videoüberwachung und Videoaufzeichnung, auf Zahlung eines Schmerzensgeldes sowie auf Auskunftserteilung in Anspruch. Die Arbeitgeberin behauptete, die Videoüberwachung diene der Arbeitssicherheit in der Produktion, im Lager, im Ladebereich und auf dem unübersichtlichen Außengelände.
Das Arbeitsgericht hatte die Klage auf Auskunftserteilung abgewiesen und ihr im Übrigen stattgegeben. Die Arbeitgeberin wurde verurteilt, eine Geldentschädigung i.H.v. 15.000 EUR an den Mitarbeiter zu zahlen. Auf die Berufung der Arbeitgeberin hat das Landesarbeitsgericht die Zahlungspflicht der Arbeitgeberin im Berufungsverfahren bestätigt.
Der Anspruch folgte aus § 280 Abs. 1 i.V.m. § 253 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Die Arbeitgeberin hatte die sie gemäß § 241 Abs. 2 BGB treffende vertragliche Nebenpflicht, das Persönlichkeitsrecht des Mitarbeiterss zu schützen, verletzt. Der Anspruch folgte auch aus § 823 Abs. 1 i.V.m. § 253 Abs. 2 BGB. Das Persönlichkeitsrecht ist als sonstiges Recht durch § 823 Abs. 1 BGB geschützt. Es gehört zum Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen, selbst darüber zu entscheiden, ob Filmaufnahmen von ihm gemacht und möglicherweise verwendet werden dürfen. Ob ein Eingriff in das Recht am eigenen Bild durch Videoaufnahmen rechtswidrig ist, beurteilt sich nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Schließlich war die Videoüberwachung auch nicht nach Art. 6 Abs. 1 f DSGVO zulässig. Die Vorschrift erlaubt die Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen. Datenverarbeitende Maßnahmen, sollen sie nach Art. 6 Abs. 1 f DSGVO statthaft sein, müssen allerdings einer Verhältnismäßigkeitsprüfung standhalten (Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11.12.2019, Az. C – 708/18). Das ergibt sich bereits aus dem Wortlaut der Vorschrift. Im Streitfall war die Videoüberwachung jedoch als unverhältnismäßig anzusehen. Die Arbeitgeberin hatte z.B. nicht vorgebracht, inwiefern das Gefahrenpotential für die Arbeitnehmer so hoch ist, dass die Überwachung des gesamten Hallenbereichs notwendig erscheint, insbesondere bezogen auf den Arbeitsplatz des Mitarbeiters.
Das Hessische Landesarbeitsgericht hatte in einem Urteil vom 25.10.2010 (Az. 7 Sa 1586/09) einen Arbeitgeber zur Zahlung einer Geldentschädigung i.H.v. 7.000 EUR für eine dreimonatige Dauerüberwachung verurteilt. Die im vorliegenden Streitfall erfolgte Kameraüberwachung war deutlich intensiver. Unter Berücksichtigung der Geldentwertung und des nicht geringen Verschuldens der Arbeitgeberin war eine Geldentschädigung i.H.v. 15.000 EUR angemessen. Die Arbeitgeberin hatte sich in eklatanter Weise über die Vorgaben des Datenschutzrechts hinweggesetzt.
Urteil des Lanesarbeitsgerichts Hamm vom 28.05.2025
Aktenzeichen: 18 SLa 959/24