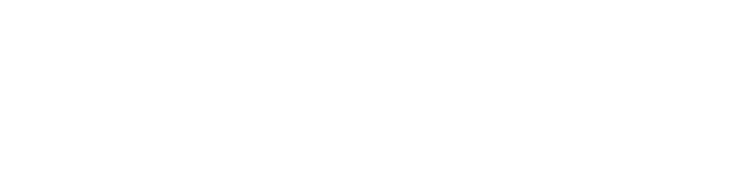Geschäftsgeheimnisgesetz: Ablehnung der Einstufung einer Funktionsweise einer Überwachungsmethode als geheimhaltungsbedürftig
Die beklagte Arbeitgeberin gehört zur Gruppe Deutsche Börse. Sie hat ihren Sitz in Frankfurt a.M. und beschäftigt ca. 160 Mitarbeiter. Sie ist Trägerin der Terminbörse „A“, einer öffentlich-rechtlichen Börse nach deutschem Recht und unterliegt damit den Vorgaben des Börsengesetzes (BörsG). Ein 1991 geborener Mitarbeiter ist seit Januar 2019 bei der Arbeitgeberin angestellt. Seit Juli 2022 ist er als „Senior Associate Vice President“ tätig. Die Arbeitgeberin kündigte das mit dem Mitarbeiter bestehende Arbeitsverhältnis mit Schreiben vom 18.12.2024 außerordentlich fristlos, hilfsweise fristgemäß zum 31.03.2025. Gegen diese Kündigung erhob der Mitarbeiter Kündigungsschutzklage. Die Güteverhandlung blieb erfolglos. Die Arbeitgeberin begründete die Kündigung damit, dass der Mitarbeiter vertrauliche, geheimhaltungsbedürftige Informationen im Internet veröffentlicht und eine nicht genehmigungsfähige Nebentätigkeit aufgenommen habe.
Mit Schriftsatz vom 27.08.2025 beantragte die beklagte Arbeitgeberin gemäß § 273a ZPO i.V.m. §§ 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG, 495 ZPO, streitgegenständliche Informationen, soweit sie die Überwachungsmethode „P* M*“ betreffen, als geheimhaltungsbedürftig einzustufen, den Zugang zu von den Parteien eingereichten und vorgelegten Dokumenten, welche Geschäftsgeheimnisse zur Überwachungsmethode enthalten können, außerdem den Zugang zum Termin der mündlichen Verhandlung sowie zum Protokoll der mündlichen Verhandlung auf bestimmte Personen zu beschränken und die Öffentlichkeit am Termin der mündlichen Verhandlung auszuschließen.
Das Arbeitsgericht hatte die Anträge zu 1) bis 3) zurückgewiesen und über die Anträge zu 4) bis 6) nicht entschieden. Sie hätten keine möglichen Geschäftsgeheimnisse i.S.d. § 2 Nr. 1 GeschGehG zum Gegenstand. Es werde nur eine Überwachungsmethode abstrakt beschrieben. Die sofortige Beschwerde der Arbeitgeberin beim Landesarbeitsgericht hatte keinen Erfolg.
Der Antrag der Arbeitgeberin war zulässig gemäß §§ 273a ZPO, 16 Abs. 1, 19 Abs. 1 GeschGehG i.V.m. §§ 46 Abs. 2 Satz 1 ArbGG, 495 ZPO. § 273a ZPO ist zum April 2025 in Kraft getreten. Nach § 37b ZPOEG ist § 273a ZPO auch in Verfahren anwendbar, die bereits am 01.04.2025 anhängig waren. Die Möglichkeit, auf Antrag Informationen als geheimhaltungsbedürftig einstufen zu lassen und den Zugang zu diesen Informationen zu beschränken, ist durch § 273a ZPO nicht mehr auf Geschäftsgeheimnisstreitsachen begrenzt. Es genügt, wenn in einem zivilrechtlichen, d.h. auch in einem arbeitsrechtlichen, Verfahren glaubhaft gemacht wird, dass eine Information ein Geschäftsgeheimnis i.S.d. § 2 Nr. 1 GeschGehG sein kann. Anders als in den unmittelbar durch §§ 16 ff. GeschGehG geregelten Fällen muss keine Geschäftsgeheimnisstreitsache vorliegen. § 273 a ZPO eröffnet damit grundsätzlich auch den Schutz sensibler Informationen, wenn – wie hier – wegen einer Kündigungsschutzklage darum gestritten wird, ob ein Arbeitnehmer durch Offenbarung oder Verwendung eines Geschäftsgeheimnisses Anlass zur Beendigung seines Arbeitsverhältnisses gegeben hat.
Im Einstufungsverfahren muss nicht bewiesen werden, dass eine streitgegenständliche Information ein Geschäftsgeheimnis i.S.v. § 2 Nr. 1 GeschGehG ist. Es genügt die Glaubhaftmachung, die Information muss das „Potenzial eines möglichen Geschäftsgeheimnisses“ haben. Die Arbeitgeberin machte vorliegend geltend, dass die Funktionsweise der Überwachungsmethode „P* M*“ als Geschäftsgeheimnis zu qualifizieren ist. Die Überwachungsmethode dürfe notwendigerweise nur den bei ihr mit dieser zur Überwachung des Börsenhandels arbeitenden Personen bekannt sein, da sie sonst ihren Zweck verfehle und umgangen werden könne. Die Kenntnis der Methodik sei xangemessen vor unbefugten Zugriffen geschützt. Sie habe ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung. Eine erfolgreiche Marktmissbrauchsüberwachung sei für sie, gerade im Verhältnis zu Wettbewerbern, von erheblichem strategischem und wirtschaftlichem Wert.
Die abstrakte Umschreibung der Funktionsweise eines Programms zur besseren Aufdeckung von Insiderhandel kann nicht als Geschäftsgeheimnis qualifiziert werden, wenn diese nicht ihrem Inhalt nach beschrieben oder zumindest dargelegt wird, was das Programm von anderen Softwarelösungen zur Aufdeckung von Insiderhandel unterscheidet oder welcher konkrete Programmbestandteil „neu“ ist und zu besseren Ergebnissen als andere Programme führt. Eine Funktionsweise ist nur dann eine geheimhaltungsbedürftige „Information“, wenn sich aus der Beschreibung für fachkundige Personen die Möglichkeit ergibt, diese nachzubilden. Ein „rechtsverletzendes Produkt“ i.S.d. § 2 Nr. 4 GeschGehG kann in seiner Funktionsweise, wie von dieser Norm erfasst, nur auf einem rechtswidrig offengelegten Geschäftsgeheimnis beruhen. Dies setzt jedoch voraus, dass die Funktionsweise nachgestaltet werden kann. Dazu enthielt der Vortrag der Arbeitgeberin keine Angaben. Es wurde behauptet, dass ein Geschäftsgeheimnis vorliegt, ohne anzugeben, was dieses in Verbindung mit nicht geheimhaltungsbedürftigen Faktoren ausmacht.
Die Arbeitgeberin hatte keine Ausführungen dazu gemacht, weshalb sie vor der Darlegung der Kündigungsgründe mit Schriftsatz vom 02.04.2025 keine Einstufung bestimmter Informationen als geheimhaltungsbedürftig nach §§ 273 a ZPO, 16 Abs. 1 GeschGehG beantragt hatte, obwohl die Frist zur Begründung der Kündigung bis zum 04.04.2025 verlängert worden war. Der Arbeitgeberin wäre es nach dem Inkrafttreten des § 273a ZPO am 01. 04.2025 möglich gewesen, konkrete Informationen, welche potenzielle Geschäftsgeheimnisse i.S.d. § 2 Nr. 1 GeschGehG sein können, zunächst zurückzuhalten und sie erst nach Einstufung gemäß § 16 Abs. 1 GeschGehG vorzutragen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass dem Mitarbeiter als mit der Überwachungsmethode „P* M*“ beschäftigten Arbeitnehmer deren Funktionsweise bekannt war und ist. Das Interesse der Arbeitgeberin kann nur darauf gerichtet sein, die Nutzung und Offenlegung der Funktionsweise der Überwachungsmethode außerhalb des Verfahrens zu unterbinden. Diese Gefahr ist wegen der nur abstrakten Umschreibung nicht erkennbar.