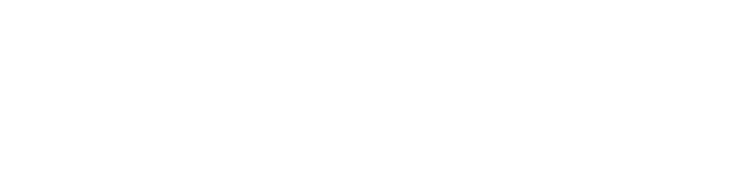Verfall gesetzlichen Urlaubsanspruchs kann per Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden
Die Mitarbeiterin war von Juli 2015 bis zur rechtlichen Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses am 30.06.2023 durchgehend arbeitsunfähig erkrankt. Mit Schreiben vom 14.07.2023 forderte sie den Arbeitgeber erfolglos zur Abgeltung ihres Resturlaubs für die Jahre 2016 bis 2021 in Höhe von 16.908 EUR auf. Sie war der Ansicht, der gesetzliche Mindesturlaub, den sie wegen ihrer Krankheit bis Ablauf des Übertragungszeitraums am 30. April des auf das Urlaubsjahr folgenden Jahres nicht habe in Anspruch nehmen können, unterliege aufgrund der besonderen Vereinbarung in § 7 Abs. 3 des Arbeitsvertrags keinem Verfall und bestehe auf unbestimmte Zeit fort. Der Arbeitsvertrag enthalte eine gegenüber § 28 Abs. 7 AVR-DD eigenständige Regelung zum Verfall von Urlaub, die diese und die gesetzlichen Bestimmungen zum Urlaubsverfall verdränge.
Der Arbeitgeber hatte gegen die Klageforderung eingewandt, die im Streit stehenden Urlaubsansprüche seien spätestens 15 Monate nach Ablauf des jeweiligen Urlaubsjahres erloschen. Die Parteien hätten unmissverständlich die „Geltung der AVR“ vereinbart, bei deren Anwendung der Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub im Falle einer langanhaltenden Erkrankung des Arbeitnehmers mit Ablauf der von der Rechtsprechung entwickelten 15-Monatsfrist verfalle. Die Regelung in § 7 Abs. 3 des Arbeitsvertrags schließe es nicht aus, die AVR-DD zumindest ergänzend anzuwenden.
Das Arbeitsgericht hattedie Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht hatte ihr im Berufungsverfahren stattgegeben. Das Bundesarbeitsgericht hat die hiergegen gerichtete Revision des Arbeitgebers zurückgewiesen.
Der Entstehung des Anspruchs auf den gesetzlichen Mindesturlaub stand die vom 31.07.2015 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses durchgehend anhaltende krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiterin nicht entgegen. Arbeitnehmer, die wegen einer Krankschreibung während des Bezugszeitraums der Arbeit ferngeblieben sind, und solche, die während dieses Zeitraums tatsächlich gearbeitet haben, sind hinsichtlich Entstehung und Berechnung des Urlaubsanspruchs gleichgestellt (Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom o4.10.2018, Az. C-12/17 – [Dicu]; Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 05.12.2023, Az. 9 AZR 364/22).
Die Urlaubsansprüche waren auch nicht aufgrund der langandauernden Erkrankung der Mitarbeiterin mit Ablauf von 15 Monaten nach Beendigung des jeweiligen Urlaubsjahres erloschen. Denn eine Regelung, die diese Rechtsfolge anordnet, fand auf das Arbeitsverhältnis keine Anwendung. Die Parteien hatten den Verfall des gesetzlichen Urlaubsanspruchs nach § 7 Abs. 3 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) bei Vorliegen einer Langzeiterkrankung wirksam vertraglich ausgeschlossen. War der Arbeitnehmer – wie hier – seit Beginn des Urlaubsjahres durchgehend bis zum 31. März des zweiten auf das Urlaubsjahr folgenden Kalenderjahres – d.h. bis 15 Monate nach Beendigung des Urlaubsjahres – arbeitsunfähig, verfällt der Anspruch auf den gesetzlichen Mindesturlaub bei unionsrechtskonformer Auslegung von § 7 Abs. 3 BUrlG unabhängig davon, ob der Arbeitgeber seinen Mitwirkungsobliegenheiten nachgekommen ist.
Der 15-monatige Übertragungszeitraum gilt auch dann für den gesetzlichen Mindesturlaub, wenn eine kollektiv-rechtliche Vereinbarung dem Arbeitnehmer einen den Mindesturlaub übersteigenden Urlaubsanspruch einräumt, jedoch – wie § 28 Abs. 7 AVR-DD – für den Gesamturlaubsanspruch einheitlich einen kürzeren Übertragungszeitraum für den Fall einer Langzeiterkrankung vorsieht. Eine solche Regelung ist bezüglich des gesetzlichen Urlaubs gem. § 134 BGB i.V.m. § 13 Abs. 1 Satz 1 bzw. Satz 3 BUrlG teilweise nichtig. An ihre Stelle tritt § 7 Abs. 3 BUrlG in seiner unionsrechtskonformen Auslegung.
Vorliegend hatten die Parteien durch die Regelung in § 7 Abs. 3 Satz 3 ihres Arbeitsvertrags § 7 Abs. 3 BUrlG in seiner unionsrechtskonformen Auslegung jedoch verdrängt und einen Verfall des gesetzlichen Mindesturlaubs bei einer Langzeiterkrankung zugunsten der Mitarbeiterin ausgeschlossen. Dies ergab die Auslegung der Vertragsklausel. Bedienen sich die Kirchen – wie der Arbeitgeber durch eine von den AVR-DW-EKD (nunmehr AVR-DD) abweichende Vertragsgestaltung – jedermann offenstehender privatautonomer Gestaltungsformen, unterliegen sie unter Berücksichtigung ihres Selbstverwaltungs- und Selbstbestimmungsrechts den zwingenden Vorgaben staatlichen Arbeitsrechts (vgl. Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 05.10.2023, Az. 6 AZR 210/22).